 Lehrstoffverteilungen für
Fachkunde |
Elektrotechnik |
Fachzeichnen |
Laborübungen
Lehrstoffverteilungen für
Fachkunde |
Elektrotechnik |
Fachzeichnen |
Laborübungen Fragen
FragenMAK-Betriebs- und Schutzarten elektrischer Maschinen
[FK/EMT]

Erwärmung von Maschinen
Die Erwärmung von Maschinen erfolgt nach einer sogenannten Exponentialfunktion.
Für die Erwärmungskurve steht in der Hochzahl ( = der Exponent) das Verhältnis der Zeit t zu der Zeitkonstante τ (sprich: "TAU") und die Basis ist die Eulersche Zahl e ( = 2,71828). Per Taschenrechner kann die Exponentialfunktion mit der Taste ex berechnet werden.

Mit dieser Potenzfunktion lässt sich jede Erwärmungszeitkurve berechnen. Das Diagramm der Temperaturkurve über der Zeit sieht immer wie folgt aus:
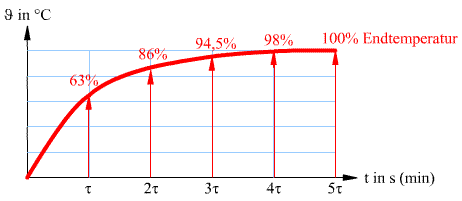
Für die Erwärmung gilt
Für die Abkühlung gilt
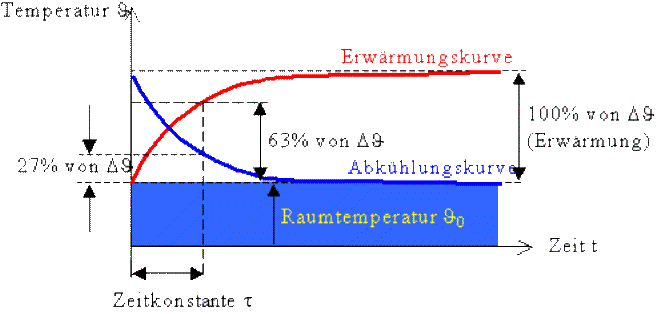
Betriebsarten
Motoren müssen so bemessen werden, dass die zulässigen Wicklungstemperaturen bei der vorgesehenen Betriebsart nicht überschritten werden.
Wir unterscheiden:
Dauerbetrieb S1
Der Motor läuft so lange mit Nennlast, dass er die Endtemperatur erreicht;
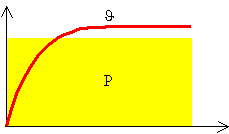
Kurzzeitbetrieb S2
Der Motor läuft zu kurz, um sich auf Endtemperatur zu erwärmen. Die Betriebspause reicht zum vollständigen Auskühlen des Motors aus.
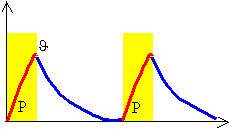
Aussetzbetrieb S3
Die Betriebspause reicht zum vollständigen Auskühlen des Motors nicht mehr aus.
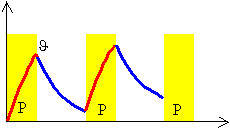
Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung S6
Der Motor kann sich im Leerlauf nicht abkühlen.
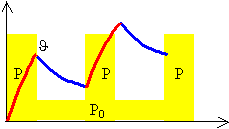
Betriebsartenumrechnung
Vom Dauerbetrieb in Kurzzeitbetrieb
Wird eine Maschine statt im Dauerbetrieb (S1) im Kurzzeitbetrieb (S2) verwendet, kann die geforderte Leistung vergrößert werden.
Es gilt:
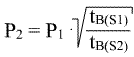
dabei ist
- tB(S1) ... die Zeit für den Dauerbetrieb oder 5τ < tB
- tB(S2) ... die Zeit für den Kurzzeitbetrieb oder t << 5τB
Vom Dauerbetrieb in Aussetzbetrieb
Wird eine Maschine statt im Dauerbetrieb (S1) im Aussetzbetrieb (S3) verwendet, und ist die Abkühlungszeitkonstante sicher kleiner als die Stillstandszeit tSt (5τ < tSt), dann kann die geforderte Leistung ebenfalls vergrößert werden.
Es gilt:
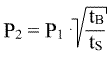
dabei ist
- tS ... die Spieldauer
- tB ... die Betriebszeit
Lastwechselbetrieb
Wenn während des Betriebes verschiedene Belastungen auftreten (S6), wird die durchschnittliche Leistungsabgabe der Maschine wie folgt berechnet:
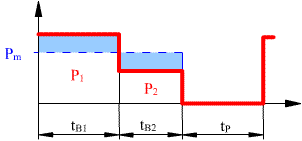
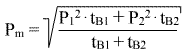
Für die weitere Berechnung ist:
- tS = tB1 + tB2 + tP ... die Spieldauer
- tB = tB1 + tB2 ... die Betriebszeit
- Pm = P1 ... die Ausgangsleistung
Vom Kurzzeitbetrieb in Dauerbetrieb
Für die Spieldauer kann bei gleichbleibender Betriebsart auch die relative Zeit in 100% angegeben werden. Dann ist die Betriebszeit des Motors die Einschaltdauer ED in % der Spieldauer tS. Somit gilt:
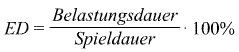
und
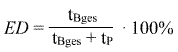
Bei Motoren ohne spezielle ED-Angabe kann der Einsatz im Dauerbetrieb angenommen werden. ED - Motoren (zB: ED 15%; 25%; 40%; 60%) können bei der angegebenen Leistung nicht im Dauerbetrieb laufen! Bei ihnen gilt:
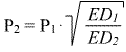
- der Index (1) ... steht für die Werte vor dem Umbau
- der Index (2) ... steht für die Werte nach dem Umbau
So kann die Beziehung für die Berechnung der
- Leistungserhöhung bei Betriebszeitverkürzung oder für
- Leistungsverringerung bei Betriebszeiterhöhung herangezogen werden.
Schutzarten von elektrischen Maschinen
Unter Schutzarten verstehen wir die konstruktiven Maßnahmen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (Wasser) und Festkörpern in das Gehäuse.
Das Bezeichnungssystem besteht aus dem Kürzel IP xx (International Protection) gefolgt von zwei Kennziffern xx:
Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern:
| Kennziffer 1 | Schutz gegen ... |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | ... große Fremdkörper (Ø > 50 mm) |
| 2 | ... mittelgroße Fremdkörper (Ø > 12 mm) |
| 3 | ... kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm) |
| 4 | ... kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm) |
| 5 | ... Staubablagerung (Eindringen nur in einem Maß, das die Arbeitsweise nicht beeinträchtigt wird) |
| 6 | ... Eindringen von Staub |
Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten:
Begriffe für das Eindringen von Wasser:
| Kennziffer 2 | Schutz gegen ... |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | ... senkrecht fallendes Tropfwasser |
| 2 | ... schräg fallendes Tropfwasser |
| 3 | ... Sprühwasser |
| 4 | ... Spritzwasser |
| 5 | ... Strahlwasser |
| 6 | ... schädliche Feuchte bei überflutung |
| 7 | ... schädliche Feuchte bei kurzem Eintauchen in Wasser |
| 8 | ... schädliche Feuchte bei Untertauchen bis zu einem bestimmten Druck |